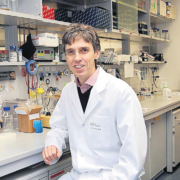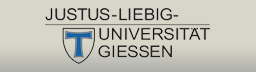Biologieunterricht 1968… und 2014
Im Frühjahr 2013 mussten wir Biologen im Zuge der Sanierung des naturwissenschaftlichen Gebäudes am Philippinum die Biologie vollständig ausräumen, sichten und viele der Sammlungsexponate sicher in der Baracke zwischenlagern. Im Zuge dieser Aktion machten wir eine besondere Entdeckung.
In einem der oberen Schränke befanden sich nicht nur alte Zeitschriften und Anregungen zum Biologieunterricht aus vergangenen Zeiten, sondern auch alte Hefte von Schülerinnen und Schülern. Beim Stöbern fanden wir so auch das Biologiearbeitsheft von Roland Knoke aus dem Jahr 1968. Feinsäuberlich waren hier drei Aufsätze niedergeschrieben zu den Themen: 1. Aminosäuren und Eiweiße, 2. Die Chromosomentheorie der Vererbung und 3. Die Fotosynthese. Es sieht so aus, als habe die Lehrkraft damals zu den Leistungsüberprüfungen ein Thema an die Tafel geschrieben und jeder Schüler hat dann aus dem Gedächtnis alles aufgeschrieben und mit Formeln und Zeichnungen ergänzt, was er zu diesem Thema aus dem Unterricht behalten hat. Gerade die Darstellung von Herrn Knoke über Eiweiße und Aminosäuren, aber auch über die Vorgänge der Fotosynthese zeigen, dass er gut gelernt hat. Das meiste von dem gilt auch heute noch, würde aber kaum so abgefragt, sondern lediglich als Hintergrundwissen genutzt werden, um es auf konkrete Messungen und Beispiele anzuwenden.
Heute haben die Klausuren natürlich auch thematische Schwerpunkte, es geht aber nur im geringen Anteil um eine bloße Abfrage des Gelernten. Vielmehr werden die Schüler in den Klausuren mit Grafiken, Beobachtungen und Versuchsergebnissen innerhalb des Themas konfrontiert und sie müssen nun zeigen, dass sie auf der Grundlage des Gelernten fähig sind, das Material sachgerecht zu analysieren und zu interpretieren. Dies hat natürlich auch mit dem Auswendiglernen biologischer Prinzipien zu tun, führt aber durch die Anwendung auf konkrete Beispiele darüber hinaus. Besonders deutlich treten die Unterschiede zwischen 1968 und 2014 im Themenbereich der Genetik hervor. Hier konnte Roland Knoke gerade einmal Aussagen zu den Kreuzungsversuchen Mendels machen und tastete sich ein wenig an die Chromosomentheorie der Vererbung heran.
Durch die vielfältigen wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritte, nicht zuletzt durch die Entschlüsselung des menschlichen Genoms 2003 (Humangenomprojekt von 1990 – 2003) müssen Schüler heute weit mehr zur Genetik lernen und verstehen. Sie lernen den Aufbau der DNA bis in die Molekularebene, lernen, wie diese von welchen Enzymen abgelesen und reproduziert wird, und können dieses Wissen dann auch auf konkrete Beispiele, etwa genetische Erkrankungen, anwenden. Die Kreuzungsversuche von Mendel bleiben zwar immer noch Grundlage und müssen in der Sek I zusammen mit den Prozessen von Meiose und Mitose genau verstanden werden. Aber das größere Gewicht haben heute in der Sek II all die neueren Erkenntnisse der Genetik, die verstanden und nachvollzogen werden müssen. Schaut man sich die Benotung der Aufsätze von Herrn Knoke an, scheint er auch 1968 schon gespürt zu haben, was für ihn nachhaltiges Wissen darstellte und was nicht. Die unbestrittenen Ausführungen zu Eiweißen und zur Foto- Biologieunterricht 1968 …… synthese brachten ihm eine zwei in der Benotung ein, sein Genetikaufsatz dagegen wurde deutlich schlechter bewertet – vielleicht nicht nur, weil er selbst nur wenig dazu sagen konnte, sondern weil die Erkenntnisse bis dahin insgesamt sehr dürftig waren.
Abschließend bleibt zu sagen, dass heute wie damals Schule nicht ohne ein gewisses Maß an Lernen, und das heißt auch Auswendiglernen, auskommt, dass Schule aber heute ein weit größeres Gewicht auf die Anwendung und den konkreten Alltagsbezug des Gelernten legt. Überraschend aktuell zeigte sich eine Zusammenarbeit zwischen dem Virologie Zentrum der Universität Marburg und dem Philippinum in den letzten Ferientagen der Sommerferien. 15 Schülerinnen und Schüler aus den Grund- und Leistungskursen Biologie am Philippinum beendeten ihre Ferien freiwillig, um am 04. und 05.09.2014 an einer Simulation zur Ausbreitung eines hochinfektiösen Virus teilzunehmen. Bei der Anmeldung dazu ahnten sie nicht, wie aktuell diese Simulation sein würde, da wenige Wochen vorher das Ebolavirus in Afrika ausgebrochen war und bis heute noch nicht eingedämmt werden konnte.
So wurde das vielfältige experimentelle Arbeiten bgeleitet von aktuellen Informationen zum Ebolavirus mit einer Präsentation von Dr. Gordian Schudt über seinen Einsatz in Afrika. Die Schülerinnen und Schüler prüften in der Simulation die antivirale Wirkung unterschiedlicher Substanzen von Honig über Deo, Alkohol und Karotten und führten Genanalysen und Antikörpertests durch. Es bestätigte sich die desinfizierende Wirkung des Alkohols, während andere, teilweise naturheilkundlich propagierte Stoffe, enttäuschend wirkungslos blieben. In einer abschließenden Pressekonferenz zeigte sich der große Gewinn, den die Schülerinnen und Schüler aus der gemeinsamen Arbeit ziehen konnten. Alle betonten, dass sie jederzeit wieder, auch in den Ferien, so ein Projekt wahrnehmen würden.
Quelle: Jahrbuch 2014, Gymnasium Philippinum